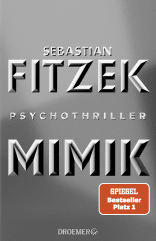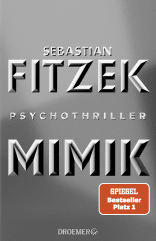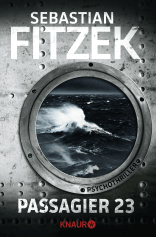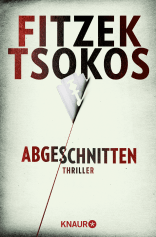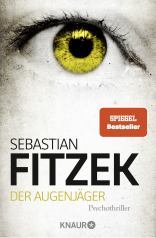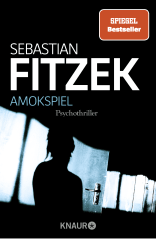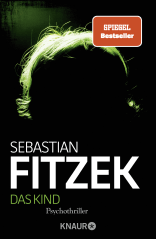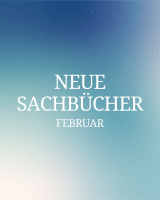Denk an das schlimmste Date deines Lebens - und du bist noch nicht einmal nahe dran!
Bestseller-Autor Sebastian Fitzek hat seinen dritten Roman geschrieben:
»Horror-Date«. Kein Thriller - obwohl man beim Dating auf viele Psychos trifft!
Ein ebenso humorvoller wie lebenskluger Roman, eine grandiose Mischung aus Humor und existentiellen Fragen.
»The Walking Date« ist keine normale Dating-Plattform: Hier können sich Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, noch ein letztes Mal verlieben. Deshalb hat sich auch Patient Raphael bei TWD angemeldet, und tatsächlich funkt es zwischen ihm und der ebenfalls erkrankten Nala. Doch am Tag ihres ersten Blind Dates geht es Raphael nicht gut. Kurzerhand überredet er seinen besten Freund, den erfolgsverwöhnten Start-up-Gründer Julius, an seiner Stelle zu dem Treffen zu gehen.
Raphael zuliebe spielt Julius widerwillig den Schwerkranken - und das schlimmste Date seines Lebens beginnt. Schon nach wenigen Minuten ist Nala schwer enttäuscht von dem attraktiven, aber furchtbar oberflächlichen Kerl, der in seinen Mails doch so tiefgründig gewirkt hat. Als sie ihn auf seine protzigen Statussymbole anspricht, flüchtet er sich in die nächste Lüge: Julius gibt vor, sein gesamtes Hab und Gut in den letzten Tagen seines Lebens verschenken zu wollen. Eine Idee, die Nala begeistert. Und damit nimmt das Unheil endgültig seinen Lauf. Bald muss Julius alles verschenken, um nicht alles zu verlieren …
Der dritte »Keinthriller« von Sebastian Fitzek nach »Der erste letzte Tag« und dem Jahresbestseller »Elternabend«
Der Bestseller-Autor begeistert nicht nur mit seinen düsteren Thrillern Millionen Leser*innen: Auch Sebastian Fitzeks humorvolle Romane mit Tiefgang standen wochenlang auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Die Fans sind sich einig: Sebastian Fitzek kann einfach gnadenlos gut erzählen!