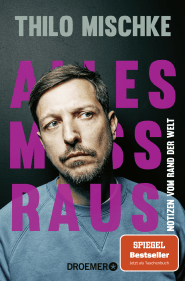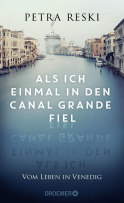Weltweit auf der Suche nach Antworten
Der Journalist Thilo Mischke hat weit über hundert Länder dieser Welt bereist. Es ist dabei nicht der Reiz des Extremen, der ihn in die entlegensten Ecken treibt, sondern sein offener Blick für Menschen und ihre Geschichten, ja ein unersättlicher Hunger auf Lebenserfahrung. Egal, ob er in El Salvador dem Tod ins Auge blickt, Freundschaft in den Weiten Islands erfährt oder ukrainische Soldaten trifft: In seinen Schilderungen aus den grausamsten und unwirtlichsten Regionen der Welt wird das Fremde plastisch, und so erscheint unsere eigene Realität in neuem Licht. Und weil Thilo Mischke auf seinen Reisen alles in sich aufnimmt, ja aufsaugt, muss am Ende alles wieder raus, aufs Papier: Er lässt uns mitreisen und zeigt, wie aufregend, herausfordernd und vielfältig die Welt ist – aber nirgendwo schwarzweiß.
"Jeder von uns hat einen Antrieb, etwas, was ihn in den Abgrund stürzen kann, aber auch auf Gipfel treibt. Für mich ist es das Neue. Ich unterwerfe mein Leben, mein Glück, meine Gesundheit der Suche nach Dingen, die ich noch nicht kenne, nicht verstehe."

"Wir leben in einem System, das uns das Gefühl gibt, für das Sich-Erfüllen von Träumen bezahlt zu werden. Das kann nur unglücklich machen. Aber es ist ein Kreislauf, die Träume werden von Menschen produziert, damit andere wieder für diese Träume arbeiten."

"Ich würde niemals behaupten, dass meine Erlebnisse mich zu einem besseren Menschen gemacht haben."

Leseprobe