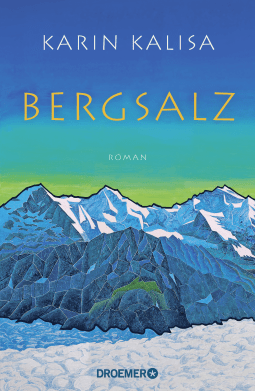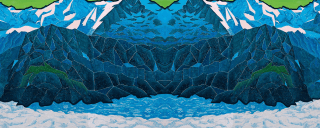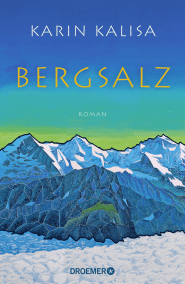Eine Graswurzelbewegung ganz eigener Art
Ein sehr aufgeräumtes Land. Eine ziemlich unaufgeräumte Küche. Und aufeinmal ganz viel Platz für neue Ideen. - Der neue Roman von Bestseller-Autorin Karin Kalisa
Franzi, Esma und Sabina finden sich in einer stillgelegten Wirtshausküche wieder. Nicht alle ›von hier‹, aber aus ähnlichem Holz. Mit einem halbleeren Kübel Alpensalz entdecken sie: Dem Leben Würze geben, ist keine Frage der Zeit. Karin Kalisa erzählt vom Vermächtnis des Fidel Endres, von einer Graswurzelbewegung ganz eigener Art, von 84 lebenserhaltenden Mineralien und der uralten Frage, wann ein Tisch zur Tafel wird, ein Mittagsmahl zum Fest, und wie einsam und gemeinsam tatsächlich einen Reim ergeben ...
Bergsalz
Ein sehr aufgeräumtes Land. Eine ziemlich unaufgeräumte Küche. Und auf einmal sehr viel Platz für neue Ideen. Franzi, Esma und Sabina finden sich in einem stillgelegten Wirtshaus
wieder. Nicht jede »von hier«, aber aus ähnlichem Holz. Ein halb leerer Kübel Alpensalz zeigt ihnen: Dem Leben Würze geben ist keine Frage der Zeit. Höchste Zeit jedoch für eine Graswurzelbewegung ganz eigener Art. Karin Kalisa erzählt von Verlassensein und Zusammenhalt, über Rückzug und Zuzug, über Alleinlagen, gemeinsame Güter und die uralte Frage: Wie viel Mitmensch braucht der Mensch?
Bergsalz
Dass man so klein wie »füreineallein« eigentlich gar nicht denken und nicht kochen kann, ist von jeher
Franziska Heberles Überzeugung. Trotzdem kommt das mittägliche Klingeln an ihrer Haustür unerwartet, ungebeten und ungelegen: eine Nachbarin. Dann noch eine. Es reicht – und reicht noch nicht. Denn auf einmal fühlt sich das Ungelegene absolut richtig und vor allem steigerungsfähig an: Doch wie kann das überhaupt gehen? Ein Mittagstisch für viele – hier, im ländlichen weiten Voralpenland, wo Einzelhof und Alleinlage seit Generationen tief in die Gemüter sickern? Und es nicht jedem passt, wenn sich etwas ändert. Esbraucht Frauen aus drei Generationen: Franzi, Esma und Sabina. Nicht alle ›von hier‹, aber aus ähnlichem Holz. Es braucht Ben, der wenig sagt, aber wenn, dann in mancherlei Sprachen; es braucht Fidel Endres, einen Vorfahren, der etwas Entscheidendes hinterlassen hat – und einen halbleeren Kübel Alpensalz in einer stillgelegten Wirtshausküche, der zeigt: Dem Leben Würze geben, ist keine Frage der Zeit.
Von 84 lebenserhaltenden Mineralien und der uralten Frage, wann ein Tisch zur Tafel wird, ein Mittags-
mahl zum Fest, und wie ›einsam‹ und ›gemeinsam‹ tatsächlich einen Reim ergeben ...
Bergsalz
Dieser Wind, den man sieht, bevor man ihn spürt. Man sieht ihn. Und man sieht ihn nicht. Man sieht, was er zu sehen gibt. Berge zum Beispiel. Die gezackte Linie ihrer Gipfel scharf umrissen wie das Relief einer Panoramakarte. So sind sie. Genau so. Und doch sind sie nicht so – nicht so nah. Er spiegelt sie vor. Wirft die Welt auf sich zurück; in pure Form und Gestalt.
Seine Klarheit ist von der Art, die Dinge scharf stellt, bis es schmerzt. Darf Welt so durchsichtig sein? Und Durchsichtigkeit so gleißend blau?
Die Schneefelder der Nordkare: zum Greifen nahe. Doch man greift ins Leere. In ein Nichts, das Berge versetzt – und meinen lässt, man rieche den Sommerschnee, wo er doch alles längst hinter sich gelassen hat: Die Kämme mit Firnisfeldern, die Gletscherzungen, die Hochmoore. Hinabgeglitten an den Nordhängen, ist er warm und wärmer geworden wie in einem schnell ansteigenden Fieber – und so leicht dabei. Jetzt kann er nichts mehr festhalten, die Kälte nicht und nicht den Schnee, keinen Regen, keinen Duft.
Es ist dieser Wind, der nichts verbirgt, nichts mit sich und nichts in sich trägt, der sonnenklar ist und doch rätselhaft in allem, was er hrvorbringt: Trugbilder, Herzrasen, Kopfweh und ein seltsames Ziehen, das den Schlaf raubt. Bevor er Boden erlangt, ist er schon unter die Haut gegangen: In seiner trockenen Wärme summen die Nerven wie elektrische Überlandleitungen. Wie lange kann das gut gehen?
Viel Zeit ist ihm nicht gegeben. Machtvoll und unaufhaltsam ist er, und doch immer kurz vor dem Zusammenbruch. Das Tief wird sich verlagern. Der Wind wird auf West drehen und ihn zum Erliegen bringen – binnen Stunden. Nordwind wird folgen – rau, doch nicht so ruppig wie der aus Osten, der zerren und zetern und den Schall der Autobahnen über die Felder tragen wird. Aber soweit ist es nicht. Noch ist er da. Überströmend vor Energie, ein Wirbel von Wärme und Lebendigkeit. Man öffnet ihm Fenster und Türen. Und müsste es nicht. Denn er findet auch so seinen Weg. Föhn zieht übers Land.
Er fällt ein in ein Haus, das gut im Wind steht – das sich gut mit dem Wind steht. Durch die Spalten zwischen den Ziegeln unters Dach fährt er und um tief zerfurchte Balken herum. Durch die geöffneten Fenster und durch die geschlossenen. Immer finden sich genügend Schlupflöcher für ihn im brüchigen Fugenkitt. Schon ist er überall.
Lässt in der Küche das Zeitungspapier rascheln, streicht über die Handtücher im Bad, weht in der Diele einen Einkaufszettel von der Kommode, treibt Reisig übers Ofenblech, bläst Staub von den Nähgarnen und lässt ihn in der Sonne tanzen – in diesem einfachen Haus, das sich selbst lüftet. Nach vier Seiten. Mit den vier Winden.
Es gehört einer Frau, die Luftbewegung für ein Lebenselixier hält: Franziska Heberle. Die Franzi. Hier wohnt sie. Und hier ist sie auch zu Hause.
Sie steht in ihrer Küche, und während sie die Kartoffeln auf den Herd setzt und beginnt, die Bohnen zu schnippeln, schaut sie ab und zu durchs Küchenfenster in den Himmel, auf die Wolkenfische, die der Föhn so schön glattgeschliffen hat. Sie mag es, wenn Dinge klar sind. Sie mag den Föhn. Gerade denkt sie darüber nach, ob sie schnell in den Garten hinaus soll für einen Stängel vom Estragon, den sie von hier aus sehen kann im Beet neben dem Gartenhäuschen. In seinen hohen Büscheln spielt der Wind. Von allerhellstem Grün sind sie, nahezu gelb – perfekt zu den Bohnen. Aber reicht die Zeit? Oder zerkochen dann die Kartoffeln, während sie Schuhe wechseln und eine Strickjacke überziehen, die kleine Schere vom Fensterbrett zur Hand nehmen, den Estragon ernten, die Schuhe zurückwechseln und die Jacke wieder ausziehen müsste? Die Schmetterlinge aus dem Sommerflieder würde sie aufstören. Ob das Geschmackserlebnis in einer Viertelstunde den schönen Anblick von jetzt ausgleichen würde? Soll sie nicht doch lieber den getrockneten Estragon aus dem Gewürzschrank nehmen? Irgendwann verdirbt der ja auch. Während sie Vor- und Nachteile bedenkt von frischem und getrocknetem Estragon und sogar noch die Alternative von Majoran erwägt, der um einiges näher am Haus steht – da brauchte sie vielleicht weder Schuhe zu wechseln noch eine Jacke überzuwerfen –, klingelt es.
* * *
Erst hatte sie gemeint, das Klingeln sei im Radio, denn wer sollte um diese Zeit klingeln? Mittagszeit. Mittagessenzubereitungszeit, da klingelt keiner. Keiner, den man kannte und dem man die Tür öffnen mochte. Die, die man kannte, taten nämlich gerade das gleiche wie man selbst: Mittagessen kochen, Mittagessen essen. Jetzt klopfte es. Erst zögerlich wie eine Frage, dann mit einer gewissen Dringlichkeit. Um nicht zu sagen Aufdringlichkeit. Klingeln ließ sich überhören, Klopfen nicht.
Wenn das jetzt wieder der Apfelbauer vom Bodensee ist, dachte Franzi. Hatte sie letztens nicht deutlich genug gesagt, dass sie sehr gern auf die Äpfel vom eigenen Baum warte. Alles zu seiner Zeit. Neue Sorten? Nein, sie war nicht interessiert. Diese eine alte hier, die reiche ihr vollkommen, hatte sie an der Tür gesagt und in den Vorgarten gedeutet, auf den Baum, der sie Jahr um Jahr zuverlässig versorgte. Ein Apfel müsse nach Herbst schmecken, nach Morgentau und Mittagssonne, nicht nach guter Lagerungsfähigkeit. Und dann diese Hybride. Halb Apfel, halb Birne. Nicht mit ihr.
Mit zwei energischen Drehs schaltete sie den Herd runter und gab der Pfanne einen Schubs aufs freie Kochfeld. Sehr verstimmt darüber, dass eine Apfeldiskussion sie jetzt am Fertigkochen hindern würde – da hätte sie ja auch gleich den Estragon aus dem Garten holen können –, öffnete sie Windfang und Haustür. Doch nicht der Apfelbauer mit seinem Korb voller Verkostungsäpfel stand dort; mit einem Emaillebecher in der Hand stand da: die Johanna. Und fragte nach Mehl.
Vielleicht, war der Franzi im Nachhinein in den Sinn gekommen, hatte die Johanna gar nicht wirklich gefragt, sondern nur den Becher so hingehalten, wie Spendensammler es tun, und etwas vor sich hingenuschelt oder auch gar nichts gesagt, und sie hatte in ihrem Innenohr einfach mit Johannas Stimme den Satz gehört, der dazu passte: »Hast a bitzle Mehl?«
Dass sie in der Erinnerung die Johanna gar nicht sprechen hörte, wunderte sie nicht. Denn Sätze wie dieser waren nicht vorgesehen. Es gab sie nicht außerhalb sehr spezieller Gegebenheiten. Und eben die waren hier nicht gegeben gewesen. Mit der Tasse vor Nachbars Tür zu stehen und Mehl leihen, das machen Stadtmenschen. Die haben eine Packung Mehl im Haus, und nach einmal Kuchen und einmal Kässpatzen ist die Packung halb leer, dann noch einmal Pfannkuchen, und schon ist für eine Mehlschwitze zu wenig da. Weil sie keine gescheite Vorratshaltung kennen, die Städter – und sie das Einkaufen einfach vergessen, bei allem, was in der Stadt los ist; wo es ja schon damit anfängt, dass es keine Parkplätze gibt und keinen ordentlichen Keller, in dem das Mehl nach Typen und Haltbarkeit in ausgemusterten Küchenschränken steht.
Wo die Kartoffeln dunkel lagern, die Äpfel nach Gebrauchszusammenhängen sortiert sind, wo die Karotten im Sand stecken und das Kraut mit Lorbeer und Wacholder im Römertopf gärt. Sie sprechen von Nachhaltigkeit, die Städter, und kennen das Vorhalten und Bevorraten nicht – und müssen, um eben mal eine Soße oder eine Flädlesuppe zu machen, nach nebenan oder eine Treppe hoch oder runter – und anklopfen.
Auf dem Dorf ist man ans Bevorraten gewöhnt. Es wäre leichtsinnig, sich daran nicht zu halten. Man kann einschneien wie im März vor fünfzehn Jahren, oder das Auto springt nicht an, oder die Straßen sind gesperrt. Stau und Steinschlag. Lieber eine Packung zu viel als eine zu wenig. Und wenn man wirklich mal kein Mehl mehr hat, kaum vorstellbar, gibt es immer noch Mondamin. Irgendetwas ist halt immer im Haus. Das war ihr in siebeneinhalb Jahrzehnten nicht passiert, dass sie um eine Tasse Mehl zum Nachbarn hat müssen – dachte Franzi, während sie Johanna ansah, diese Augen, die unendlich müde ausschauten und doch so unruhig flackerten. Die falsch zugeknöpfte Bluse und Hausschuhe, nicht mal richtig angezogen, nur eben so reingeschlupft und hinten runtergetreten. Mit hinten runtergetretenen Hausschuhen war die Johanna über die Straße zu ihr hochgelaufen, als würde der Teufel sie aus dem Haus gejagt haben – für eine Handvoll Mehl.
Diese Bücher könnten Ihnen auch gefallen


Von der Suche nach Heimat und uns selbst: eine große deutsche Familien-Geschichte am Rand des Hambacher Forstes


Ein intensiver Roman, der die Frage stellt, ob es das richtige, das perfekte Leben überhaupt gibt.


Die wechselvolle Geschichte eines italienischen Dorfes und seiner Bewohner seit den 1960er Jahren.


Von der Suche nach Heimat und uns selbst: eine große deutsche Familien-Geschichte am Rand des Hambacher Forstes


Ein intensiver Roman, der die Frage stellt, ob es das richtige, das perfekte Leben überhaupt gibt.


Die wechselvolle Geschichte eines italienischen Dorfes und seiner Bewohner seit den 1960er Jahren.